EGL073 Chinesische Filme auf der Berlinale 2025: Living the Land, The Botanist und Girls on Wire
Februar ist Berlinale Zeit und Micz hat schon letzte Episode mit dem "Rocker"-Review vorgelegt. Jetzt zieht Flo nach und setzt seine vor zwei Jahren begonnene Reihe zu chinesischen Filmen auf der Berlinale fort. Dieses Jahr hat er sich "Living the land" und "Girls on wire" im Wettbewerb und "The Botanist" in der Sektion Generation angeschaut. Wir steigen gleich mit der fundamentalen Frage ein, inwieweit chinesische Filmemacher:innen unter den Bedingungen eines autokratischen Systems kritische Inhalte transportieren können. Wir wollen anhand dieser Filme untersuchen, ob, wie Micz am Anfang in den Raum stellt, westliche Rezensierende versuchen, Kritik zu finden, wenn Filme in autokratischen Systemen entstehen, die auch Zensur betreiben. Flo sieht in den übergreifenden Themen der Filme durchaus Themen, die auch in China kritisiert werden. Und damit auch eine erlaubte Kritik formulieren, die die chinesische Gesellschaft beschäftigt. In den Filmen "Living the Land" und "The Botanist" stehen Kinder im Mittelpunkt der Erzählung, die bei der Großmutter aufwachsen, weil ihre Eltern als Wanderarbeiter:innen die meiste Zeit abwesend sind. Wanderarbeiter:innen stellen in China die größte Binnenmigration der Welt dar. Viele Kinder wachsen bei Verwandten auf oder werden allein gelassen, weil ihre Eltern sie nicht mitnehmen können. Das von Mao Zedong eingeführte Meldesystem "Hukou" untersagt es chinesischen Bürger:innen, in einem anderen Teil des Landes Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, als dort, wo man gemeldet ist. Da die Wanderarbeiter:innen nicht an einem festen Ort bleiben, können sie ihre Kinder nicht mitnehmen, da diese sonst keine Schulausbildung erhalten würden. Allen drei Filmen ist gemeinsam, dass die Familie als Ort der Identität und der Verletzlichkeit erfahren wird. Trotz des immensen Fortschritts in China ist die Familie nach wie vor ein starkes Band, das gerade auf dem Land die Perspektiven der nachwachsenden Generation maßgeblich bestimmt. Besonders deutlich wird dies in dem Film "Girls on Wire", den Micz und Flo gemeinsam gesehen haben. Der Film erzählt die düstere Geschichte zweier Cousinen, die zwischen Drogen, Familie und Filmindustrie gefangen sind. Die Figuren sind stark und verletzlich zugleich. Die Stellung der Frau in der chinesischen Gesellschaft, die Armut der Landbevölkerung, die Folgen der Ein-Kind-Politik, die zerrütteten Familienverhältnisse der Wanderarbeiter - diese Themen werden in der kleinen Auswahl chinesischer Filme auf der Berlinale angesprochen. Flo betont, dass diese Filme auch in China zum Arthouse-Genre gehören und nicht von einem chinesischen Massenpublikum gesehen werden. Obwohl diese Filme nur ein kleines Publikum erreichen, bieten sie uns einen wertvollen Einblick in die chinesische Gesellschaft.
Shownotes
- Lauftrack
- EGL073 | Wanderung | Komoot
- Links zur Episode
-
Großer Bunkerberg – Wikipedia
- | Berlinale | - Sheng xi zhi di | Living the Land
-
Living the Land – Wikipedia
-
Internationale Filmfestspiele Berlin 2025 – Wikipedia
- Living the Land im Berlinale-Wettbewerb: fokussiertes Mehrgenerationenporträt aus China | rbb24
- „Living the Land“ von Huo Meng: Vor der großen Landflucht | taz.de
-
Jeff Wall – Wikipedia
-
Die durch die Hölle gehen – Wikipedia
-
Ein-Kind-Politik – Wikipedia
-
Mao Zedong – Wikipedia
-
Großer Sprung nach vorn – Wikipedia
-
Große Chinesische Hungersnot – Wikipedia
-
Art College 1994 – Wikipedia
-
Mingong – Wikipedia
-
Hukou – Wikipedia
-
Shenzhen – Wikipedia
-
Chongqing – Wikipedia
- Binnenmigration in China: Kann die städtische Integration gelingen? | China | bpb.de
-
Tian’anmen-Massaker – Wikipedia
- Deepseek
- | Berlinale | - Zhi Wu Xue Jia | The Botanist | Der Botaniker
-
Westchina – Wikipedia
-
Han (Ethnie) – Wikipedia
-
Ne Zha 2 – Wikipedia
-
Schillerpromenade – Wikipedia
-
Vivian Qu – Wikipedia
-
Feuerwerk am helllichten Tage – Wikipedia
-
Diao Yinan – Wikipedia
-
Oriental Movie Metropolis - Wikipedia
Transcript
Verwandte Episoden
Subtile Kritik im Schatten der Zensur: Neue Stimmen des chinesischen Kinos
Die Berlinale 2024 bot einen aufschlussreichen Einblick, wie chinesische Filmemacher:innen unter den Bedingungen staatlicher Kontrolle arbeiten. In einem System, das selbst die Äußerungen seiner Bürger:innen im Ausland überwacht, haben sich raffinierte Wege der indirekten Kritik entwickelt. Statt frontaler Systemkritik nutzen Künstler:innen gesellschaftlich akzeptierte Diskurse: Die Umweltbewegung findet Gehör, der Stadt-Land-Konflikt wird offen diskutiert, und auch die Folgen der mittlerweile gelockerten Ein-Kind-Politik – eine alternde Gesellschaft und der demographische Männerüberschuss auf dem Land – können thematisiert werden.
Besonders das Schicksal der Wanderarbeiter:innen und ihrer zurückgelassenen Kinder zieht sich wie ein roter Faden durch das aktuelle chinesische Kino. Die dadurch entstehenden familiären Zerrüttungen, bei denen Kinder ihre Eltern kaum kennen oder ganz allein aufwachsen müssen, spiegeln sich in zwei der drei vorgestellten Filme wider.
„Living the Land“ – Ein Meisterwerk des neuen chinesischen Kinos
Huo Mengs mit dem Silbernen Bären ausgezeichnetes Gesellschaftsporträt spielt 1991 in einem chinesischen Dorf, zu einer Zeit, als China am Beginn seines wirtschaftlichen Aufstiegs stand. Der Film folgt dem 10-jährigen Chuang durch ein Jahr voller Umbrüche. Seine Eltern arbeiten in der Boom-Stadt Shenzhen, während er bei Verwandten lebt – eine Konstellation, die heute Millionen chinesischer Kinder betrifft.
Zwischen Tradition und Moderne
Die Geschichte beginnt symbolträchtig mit der Umbettung eines hingerichteten Vorfahren und entwickelt sich entlang der vier Jahreszeiten. In präzise komponierten Bildern, die an impressionistische Gemälde erinnern, entfaltet sich ein komplexes Familiengeflecht: Die junge Tante Xiuying, deren ungewollte Schwangerschaft in eine Zwangsheirat mündet, der geistig behinderte Cousin Jihua und die Urgroßmutter als traditionelles Familienoberhaupt.
Der Film besticht durch seine authentische Darstellung des Landlebens. In langen, ungeschnittenen Einstellungen dokumentiert er die Weizenernte, Familienfeste und den verzweifelten Versuch der Modernisierung durch den Kauf eines Traktors. Die erdige Farbpalette und die distanzierte Kameraführung unterstreichen den dokumentarischen Charakter.
Gesellschaftlicher Wendepunkt
Wie der Regisseur auf der Berlinale-Pressekonferenz betonte, geht es ihm um die Verknüpfung des massiven Wandels mit intimen Momenten. Der Film zeigt den Zusammenprall zwischen technischem Fortschritt und tausendjähriger Agrartradition. Besonders beeindruckt die Darstellung der Frauenrollen, deren Resilienz und harte Arbeit das Überleben der Familie sichern.
Symbolische Tiefe und visuelle Kraft
Die Farbkodierung des Films arbeitet gezielt mit Weiß für Tod und Begräbnisse sowie Rot für Blut und Hochzeiten. Besonders eindrücklich sind die Szenen, in denen diese Symbolik zusammenfließt – etwa wenn Blut im Wasser zu sehen ist. Der Film entwickelt dabei eine fast physische Präsenz: Man meint, die kühle Herbstluft zu spüren, wenn Feuerwerk gezündet wird oder Holz verbrennt.
Das abrupte Ende mit dem im Matsch festgefahrenen Traktor wird zum vieldeutigen Symbol für eine Gesellschaft im Umbruch. Der Film schließt damit einen Bogen, der mit der Ausgrabung des hingerichteten Urgroßvaters begann und über surreale Momente – wie nach dem Tod des geistig behinderten Sohnes – bis zur Andeutung der kommenden Landflucht führt.
„The Botanist“ – Poetische Annäherung an eine verschwindende Welt
Das Regiedebüt von Jing Yi verlegt seine Geschichte in das Xinjiang-Tal und erzählt von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem kasachischen Jungen Arsin und dem han-chinesischen Mädchen Meiyu. Wie in „Living the Land“ steht auch hier ein Kind von Wanderarbeitern im Zentrum, das bei seiner Großmutter aufwächst.
Zwischen Realität und Poesie
Die Geschichte wird als Erinnerung von Arsins Onkel Bek erzählt, der nach Unruhen aus Beijing aufs Land flüchten musste. Der Film entwickelt eine traumähnliche Erzählweise, in der surreale Elemente wie ein Pferde-Poet die realistische Handlung durchbrechen. Die Sprachbarriere zwischen den Hauptfiguren wird durch gemeinsames Spielen und Erkunden überwunden.
Kritische Stimmen
Während die Bildgestaltung und die Dokumentation der unterrepräsentierten kasachischen Kultur gelobt werden, kritisieren viele Stimmen die fehlende narrative Struktur. Anders als seinem großen Vorbild Bi Gan gelingt es dem Regisseur nicht, eine hypnotische Wirkung zu erzeugen. Die angestrebte Naturverbundenheit des Protagonisten wirkt oft konstruiert, die Verbindung zur Botanik bleibt oberflächlich.
„Girls on Wire“ – Familiendrama im modernen China
Vivian Qus Film verwebt geschickt verschiedene Genres zu einer Aussage über die Position junger Frauen in der chinesischen Gesellschaft. Die Geschichte der Cousinen Tian Tian und Fang Di, die wie Schwestern aufwuchsen und durch dramatische Umstände wieder zusammengeführt werden, entwickelt sich von einem Familiendrama zu einem spannungsgeladenen Thriller.
Komplexe Charakterstudie
Fang Di arbeitet als Stuntfrau in einem Filmstudio und unterstützt ihre Familie finanziell, während Tian Tian sich in den Fängen der Drogenmafia wiederfindet. Ihre erste Begegnung wird symbolträchtig auf den Tag der Hongkong-Übergabe datiert. Der Film nutzt die „Drähte“ des Titels als durchgängige Metapher für die Fremdbestimmung seiner Protagonistinnen.
Zwischen den Genres
Die Regisseurin balanciert geschickt zwischen verschiedenen Tonlagen: Comic-Relief-Szenen im Filmstudio lockern die dramatische Grundstimmung auf. Dennoch kritisieren viele Rezensenten die unausgewogene Mischung aus Melodrama, Comedy und drastischer Gewalt. Die schauspielerischen Leistungen von Wen Qi und Liu Haocun werden durchweg gelobt, können aber nicht über strukturelle Schwächen hinwegtäuschen.
Neue Wege der Gesellschaftskritik
Die drei Filme zeigen exemplarisch, wie das chinesische Kino kritische Themen verhandelt, ohne mit der Zensur in Konflikt zu geraten. Ob durch historische Distanz wie in „Living the Land“, poetische Verfremdung wie in „The Botanist“ oder Genre-Hybridisierung wie in „Girls on Wire“ – alle finden ihre eigene Sprache für die Darstellung gesellschaftlicher Missstände. Dabei gelingt es besonders Huo Meng, aus den Beschränkungen künstlerische Kraft zu gewinnen und ein wahrhaft großes Gesellschaftsporträt zu schaffen.
Die Filme dokumentieren zudem den rasanten Wandel der chinesischen Gesellschaft und seine sozialen Kosten. Sie erinnern daran, dass hinter den beeindruckenden Wirtschaftszahlen menschliche Schicksale stehen – besonders die der zurückgelassenen Kinder, deren Geschichten hier stellvertretend für Millionen erzählt werden.
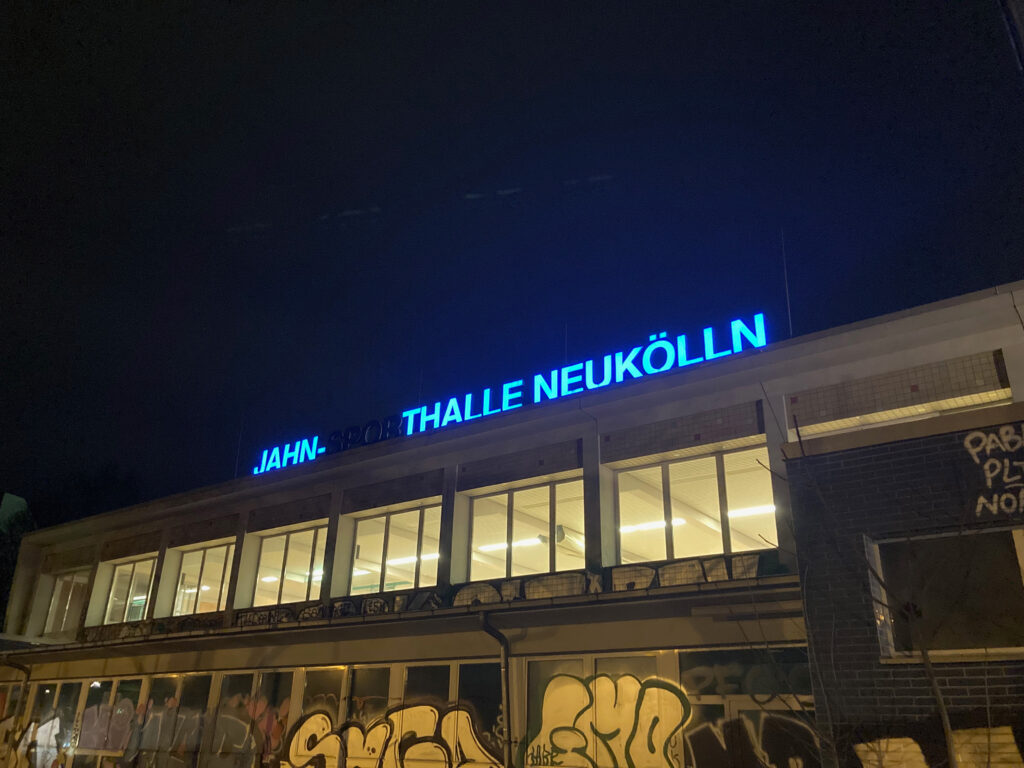




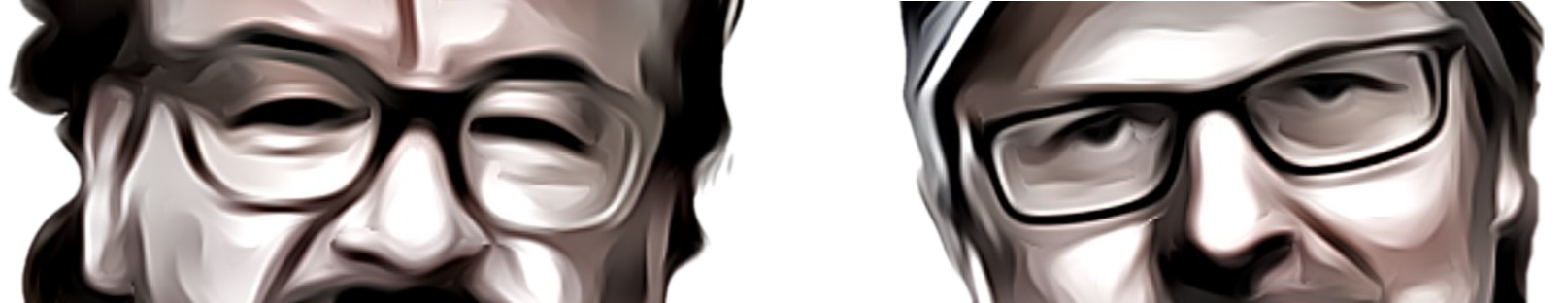


Schreibe einen Kommentar