EGL089 Body Horror 1: Titane und Weapons
Diese Episode wieder in neuer Konstellation – wir sprechen zu viert im Sitzen über Horrorfilme, speziell über Body-Horror. Reinhard Günzler und Chris sind zu Gast und jeder hat einen Body-Horrorfilm zum Besprechen mitgebracht: Reinhard stellt „Titane" vor und Chris hat sich ganz frisch im Kino „Weapons" angeschaut. Eigentlich wollten Micz und Flo noch weitere Body-Horrorfilme vorstellen, aber „The Substance" und „Together" verschieben wir auf die nächste Episode EGL090. Bevor wir in die einzelnen Filme einsteigen, schärfen wir die Definition von Body-Horror und kommen dabei immer wieder auf einen maßgeblichen Vertreter des Genres zu sprechen: David Cronenberg. Cronenberg schuf mit „Die Fliege", „Videodrome", „Crash" und vielen weiteren Filmen die Archetypen des Body-Horrors, bei denen es um Körperverlust, Grenzerfahrungen und Metamorphosen geht. Der Horror entsteht aus einer vertrauten Körperwahrnehmung, die invasiv gespiegelt wird. In den neueren Filmen des Genres stellen wir fest, dass besonders Regisseurinnen ihrer Kunst Ausdruck verleihen, da gerade hier die Zwänge, denen der weibliche Körper innerhalb eines patriarchalen Systems ausgesetzt ist, bildgewaltig dargestellt werden können. Der französische Film „Titane" von 2021 von Julia Ducournau verdichtet diese Themen in ein Kompilat, das immer wieder die Geschichte sprengt. Reinhard fasst das folgendermaßen zusammen: „Man könnte den Film auch als eine tödlich endende Passionsgeschichte beschreiben, als einen brutalen Kreuzweg oder eine dreifache Metamorphose. Also die erste Metamorphose ist vom Mensch zur (Tötungs-)Maschine, dann von einer Maschine zu einem Mann und/oder Sohn und schließlich von einem jungen Mann/Sohn wieder zurück zur Frau und sogar zur Mutter." Der Film löst in diesen Verwandlungsetappen die gesellschaftlichen und psychologischen Geschlechterrollen auf. Hinter dem Horror wird eine Geschichte von Einsamkeit und wiederentstehenden Vertrauen erzählt. Diese und andere gesellschaftlich relevante Themen sprechen wir auch dem jüngst im Kino gezeigten Film „Weapons" von Zach Cregger zu, der das schlagartige Verschwinden einer gesamten Schulklasse zum Thema macht. Bis auf die Erzählfigur Alex, 11 Jahre, rennen alle Kinder mit halb ausgestreckten Armen zu genau der gleichen Uhrzeit in die Nacht hinein und werden nicht mehr gesehen. Der Film ist episodisch erzählt und baut handwerklich geschickt die Spannung und den Horror auf. Chris berichtet, dass er während des Films schnell aufs Klo gehen musste und, um nichts zu verpassen, im eiligen Laufschritt durchs Kino gegangen ist und dabei geistesgegenwärtig die Arme so gestreckt hält, wie die Kinder beim Verschwinden. Das ganze Kino schreckt zusammen angesichts der gebrochenen Fiktion im Kinoraum. Wir lachen sehr bei dieser Anekdote. „Weapons" reißt gesellschaftlich relevante Themen auf wie Altersdiskriminierung, Alkoholismus, Pflegesystem, aber, wie Chris es auf den Punkt bringt: „Vielleicht hat ‚Weapons' keinen tieferen Sinn, aber das ist okay."
Shownotes
-
Body-Horror
-
Titane
-
Weapons (2025 film)
-
David Cronenberg
-
Die Fliege (1986)
-
Videodrome
-
Tetsuo: The Iron Man
-
Akira (Anime)
-
Crash (1996)
-
Transhumanismus
-
Tech bro
-
Alien Earth
-
Suspiria (2018)
-
Tilda Swinton
-
Tanz der Teufel
-
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
-
Das Ding aus einer anderen Welt (1982)
-
The Last of Us
-
District 9
-
Lucio Fulci
-
Shining (Film)
-
Freaks (1932)
-
Der Exorzist
-
Das Unheimliche
-
Die Elixiere des Teufels
-
Freddy Krueger
-
Julia Ducournau
-
Raw (2016)
-
Ein andalusischer Hund
-
Jacob’s Ladder – In der Gewalt des Jenseits
-
The Wrestler – Ruhm, Liebe, Schmerz
-
Mickey Rourke
-
Rashomon – Das Lustwäldchen
-
Joker (2019)
-
Es (2017)
-
Kinder des Zorns
-
Medusa
- Cronenberg on Cronenberg : Cronenberg, David : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
Transcript
Körper im Widerstand: Eine Vermessung des Body-Horror
Was wir meinen, wenn wir Body-Horror sagen
Body-Horror bezeichnet ein Feld des Horrorkinos, in dem nicht primär ein äußerer Feind oder ein übernatürlicher Akteur den Schrecken erzeugt, sondern der Körper selbst – seine Durchlässigkeit, Veränderlichkeit, sein Verfall. Der Horror entsteht dort, wo Integrität, Identität und Autonomie an der materiellen Grenze des Fleisches verhandelt werden. Das Subgenre arbeitet mit Ekelreizen und Schmerzbildern, aber seine Stärke liegt weniger in der reinen Zurschaustellung als im Nachweis, dass kulturelle, politische und psychische Konflikte in den Körper eingeschrieben sind. Anders als im Splatterfilm, der Verletzung oft als spektakulären Effekt organisiert, macht Body-Horror die Transformation des Körpers selbst zur Aussage: Er zeigt, wie Normen und Technologien auf Organen, Haut und Haltungen wirksam werden – und wie diese Materialität zurückschlägt.
Genealogie des Unbehagens: Cronenberg und die Geburt einer Moderne
Die moderne Grammatik des Body-Horror ist ohne David Cronenberg nicht denkbar. In frühen Arbeiten wie Shivers (1975) und Rabid (1977) verknüpfte er Sexualität, Krankheit und Urbanität zu dem, was er selbst einmal „venereal horror“ nannte: ein Kino der Ansteckungen, das die vermeintlich sichere Grenze zwischen Innen und Außen auflöst. Videodrome (1983) formuliert mit seinem Leitmotiv der „neuen Fleischlichkeit“ eine medienphilosophische These: Bilder sind nicht nur Repräsentationen, sondern Eingriffe – Bildtechnologien kolonisieren Körper, Körper absorbieren Technologie. The Fly (1986) universalisierte diese Einsicht zu einer Liebestragödie des Alterns und Zerfalls: Das Experiment, die Optimierung, kippt in eine Metamorphose, die als Tod und Geburt zugleich lesbar ist. Dead Ringers (1988) verlegt das Monströse in sterile chirurgische Räume und fragt, wie Zwillinge als zwei Körper ein Begehren teilen können, das sie zerreißt. Crash (1996) schließlich radikalisiert die Verbindung von Technik und Haut: Auto, Narbe, Lust – das Trauma als Einschreibung einer Moderne, die nicht mehr zwischen Unfall und Erregung trennt. In allen Fällen ist es derselbe Grundsatz: Der Körper ist keine stabile Hülle; er ist die primäre Realität, in der gesellschaftliche Abstraktionen gravieren.
Diese Linie markiert keine isolierte Autorhandschrift, sondern eine Traditionsbildung. John Carpenters The Thing (1982) und seine formale Perfektion des organischen „Werdens“ gehören ebenso dazu wie die japanischen Industrial-Exzesse eines Tetsuo: The Iron Man (1989), in dem Metall und Fleisch zu einem einzigen, aggressiven Organismus verschmelzen. Der Kanon wird dabei nicht nur durch Effekte bestimmt, sondern durch Ideen: Wie wird Kontrolle gedacht? Woher kommt das Begehren? Wer besitzt wessen Körper?
Ästhetik der Oberfläche: Formen, Motive, Blickregime
Body-Horror ist eine Ästhetik des Nahbereichs. Close-ups von Haut, Poren, Narben, Nähten, Schleimhäuten und Prothesen sind keine bloßen Ekelsignale, sondern methodische Instrumente: Sie entziehen dem Blick Distanz und zwingen zur „Berührung“ mit dem Auge. Praktische Effekte – Masken, Modelle, animatronische Details – erzeugen dabei eine spezifische Glaubwürdigkeit. Wenn der Körper reißt, wenn ein Fremdkörper die Haut nach außen drückt, ist das Bild nicht nur gesehen, sondern imaginiert gefühlt. CGI hat längst seinen Platz gefunden, doch seine stärksten Momente hat das Subgenre dort, wo digitale Mittel konkrete Oberflächen nur verlängern, nicht ersetzen.
Die Motive sind vielfältig, doch sie lassen sich grob bündeln. Infektions- und Parasitenhorror (The Thing; Slither, 2006) inszeniert das Kapern des Körpers als Verlust der Willensfreiheit. Metamorphose und Mutation (The Fly; Bite, 2015) zeigen progressive Verwandlung als Spiegel von Reifung, Krankheit oder Sucht. Chirurgie und Body-Modification (Dead Ringers; The Skin I Live In, 2011; Crimes of the Future, 2022) richten den Blick auf die Schnittstelle zwischen Selbstermächtigung, Kunst und Gewalt. Techno-Organik und Transhumanismus (Videodrome; eXistenZ, 1999; Possessor, 2020) verhandeln die Frage, wo das „Ich“ endet, wenn Interfaces in Nervenbahnen greifen. Reproduktion und Schwangerschaft (The Brood, 1979; Huesera: The Bone Woman, 2022) reartikulieren den Körper als Gefäß und Austragungsort sozialer Projektionen. Öko- und Myko-Horror (Annihilation, 2018; The Last of Us, 2023) materialisieren Klima- und Pandemieängste als Symbiosen und Überwucherungen.
Zentral ist die Blickpolitik: Wer sieht, und aus welcher Position? Body-Horror kann den male gaze reproduzieren – oder ihn durch Gegenblicke und ästhetische Strategien neutralisieren. Cronenberg verschiebt den Voyeurismus oft ins Kognitive: Seine Kamera ist klinisch, nicht lüstern. Arthouse-nahes Gegenwartskino treibt diese Entsexualisierung weiter, indem es Ekelbilder mit Empathie für Verwundbarkeit koppelt. Das Ergebnis ist weniger Schock als Erkenntnis: Die Oberfläche ist nie „nur“ Oberfläche; sie trägt die Spur.
Gegenwart: Diversifizierung, Arthouse-Crossover, neue Perspektiven
Seit den 2010er Jahren hat Body-Horror eine deutliche Breitenwirkung gewonnen, ohne seine radikale Spitze einzubüßen. Julia Ducournau brachte mit Raw (2016) und Titane (2021) eine feministische, melancholisch-zärtliche Perspektive in ein Terrain, das zuvor häufig männlich und technisch konnotiert war. In Raw ist Kannibalismus Coming-of-Age und Begehren – nicht als Provokation, sondern als Metapher für die Überforderung, die in die Welt der Erwachsenen führt. Titane sprengt Kategorien, indem es Geschlecht, Familie und Maschinenbegehren in einen Metamorphose-Rausch überführt, der Härte mit Fürsorge verschränkt. David Cronenberg selbst kehrte mit Crimes of the Future (2022) in ein altersmildes, zugleich wagemutiges Terrain zurück: Performance-Chirurgie, bürokratisierte Organe, die Erotik des Eingriffs – ein Alterswerk, das seine eigenen Frühwerke kommentiert und die Frage stellt, ob der Körper nicht längst eine Bühne ohne „Original“ ist.
Parallel schärft Brandon Cronenberg mit Antiviral (2012), Possessor (2020) und Infinity Pool (2023) den techno-organischen Strang: Celebrity-Krankheiten als Ware; Körper-„Besitz“ per Neuraltech; Klon-Strafrituale, in denen Identität austauschbar wird. Diese Filme denken Körper als Schnittstellen, in denen Ökonomien und Protokolle zirkulieren. Almodóvars The Skin I Live In (2011) führt die chirurgische Kontrolle als melodramatische Grausamkeit vor und verknüpft Identität mit Haut als Material. American Mary (2012) der Soska-Schwestern verhandelt Body-Modifikation zwischen Selbstermächtigung und Ausbeutung. Swallow (2019) macht eine Zwangsstörung zur Körperpolitik innerhalb häuslicher Machtverhältnisse. Und das Öko-/Myko-Feld – Annihilation, The Last of Us – entwirft eine Welt, in der Körper ohne klare Grenze zwischen Individuum und Umwelt existieren. Das Bemerkenswerte ist nicht nur das thematische Spektrum, sondern die ästhetische Sorgfalt: Body-Horror ist festivalfähig geworden, ohne handwerkliche Radikalität einzubüßen.
Politiken des Fleisches: Markt, Geschlecht, Medien
Jenseits der offensichtlichen Schocks liegt die intellektuelle Attraktivität des Body-Horror in seiner Fähigkeit, abstrakte Ordnungen als körperliche Effekte zu zeigen. Der Körper als Ware – Organe, Haut, Krankheiten, Falten – ist ein wiederkehrendes Motiv, das von Antiviral bis Crimes of the Future reicht. Biokapitalismus wird nicht nur behauptet, sondern buchstäblich geschnitten, geformt, implantiert. Die Wellness- und Influencerkultur des 21. Jahrhunderts liefert dabei weniger Inhalte als Formate: Routinen, Timer, App-gesteuerte Selbstoptimierung erzeugen Zeitregime, in die Subjekte ihren Körper einschreiben. Body-Horror antwortet darauf, indem er zeigt, was aus dem Raster fällt: Schweiß, Blut, Hautunreinheiten, Wucherungen – das Abjekte im Sinne Julia Kristevas, das Ausgeschlossene, kehrt an die Oberfläche zurück.
Gleichzeitig erlaubt das Subgenre eine präzise Bearbeitung geschlechtlicher Politiken. Wenn Schwangerschaft zur Folie des Unheimlichen wird, reflektiert das nicht „Natur“, sondern gesellschaftliche Regimes von Kontrolle, Fürsorge und Angst. Wenn eine Figur ihren Körper modifiziert, steht dahinter nicht nur individueller Wille, sondern die Frage, wer definieren darf, was ein „gelungener“ Körper ist. Ducournaus Kino antwortet darauf mit Zärtlichkeit im Extrem – der Verletzliche ist der Maßstab, nicht der Normkörper. Cronenbergs späte Arbeiten sind gelassener: Er suggeriert, dass der Körper längst „öffentlich“ ist; die Frage ist, wie wir ihn lesen. In diesem Sinn ist die Mediensphäre von Videodrome bis zu zeitgenössischen Social-Media-Ästhetiken kein Außen: Bilder sind Operationen, und Operationen sind Bilder.
Form und Material: Warum praktische Effekte wichtig bleiben
Die formale Ökonomie des Body-Horror begünstigt Praktiken, die Materialität erfahrbar machen. Praktische Effekte erzeugen Widerstand: Licht bricht anders auf Latex als auf Pixeln, Klebstofffugen haben eine eigene Semantik, Blut ist in der Viskosität sprechender, wenn es sich nicht vollständig kontrollieren lässt. Diese Widerständigkeit korrespondiert mit einem Ton, der nüchtern bleiben kann, ohne den Ekel zu denunzieren. Cronenberg hat die klinische Kamera etabliert, die Diagnose statt Voyeurismus sucht. Viele Gegenwartsfilme übernehmen diesen Zug: Je präziser Licht, Farbe und Geräusche gesetzt werden, desto weniger geht es um Überrumpelung, desto mehr um eine Lesbarkeit von Körpern, die verletzt und verletzend sind. Das bedeutet nicht, dass das Subgenre sich dem Spektakel verweigert; vielmehr kalibriert es den Effekt auf Bedeutung: Ekel als Erkenntnis.
Das letzte Reale
Der Reiz des Body-Horror liegt darin, dass er eine alte Einsicht des Kinos erneuert: Der Körper ist die Bühne, auf der sich das Politische, Soziale und Intime kreuzen. Indem das Subgenre die Oberfläche in den Mittelpunkt rückt, entwertet es das Innere nicht; es macht nur sichtbar, dass das Innere ohne Oberfläche nicht zu haben ist. In Zeiten, in denen Optimierungs- und Verfügbarkeitsphantasien den Alltag strukturieren, erweist sich die Form als kritisch: Sie unterläuft das Versprechen der glatten Hülle, indem sie die Naht zeigt. David Cronenbergs Werk hat hierfür die Grammatik geliefert, viele Gegenwartsfilme haben den Wortschatz erweitert. Was bleibt, ist eine doppelte Bewegung: Body-Horror zwingt uns, hinzusehen, und erinnert uns daran, dass Sehen eine körperliche Tätigkeit ist. Das Kino, das hier entsteht, ist nicht nur ein Kino des Schreckens, sondern eines der Erkenntnis – nüchtern, präzise, mitunter grausam. Es nimmt seinen Gegenstand ernst: den Körper, der begehrt und leidet, der modelliert wird und sich entzieht. Und es behauptet – souverän, ohne Pathos –, dass gerade dieser Körper die letzte Instanz ist, in der die großen Abstraktionen unserer Gegenwart Wahrheit werden.
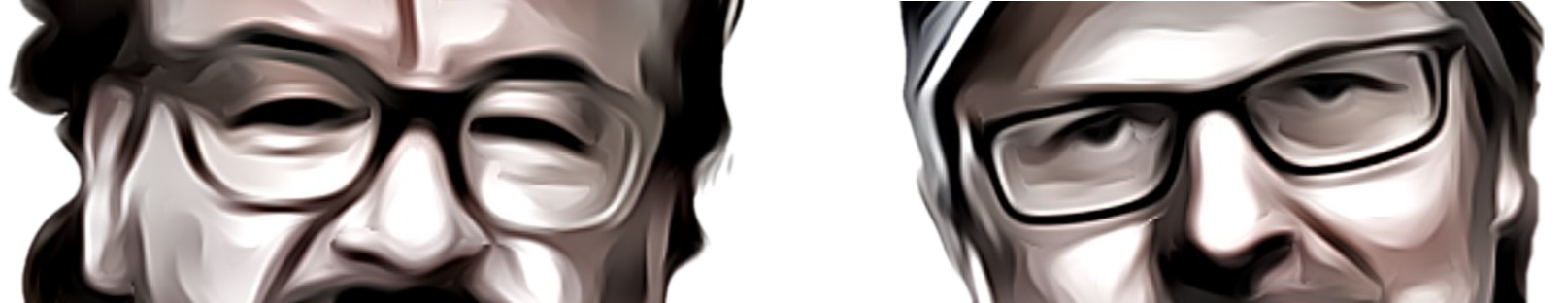




Schreibe einen Kommentar