EGL083 London in Serien: zwischen Geldwäsche und Genrekunst
Flo hat in letzter Zeit viele Serien geschaut, die in London spielen: MobLand, I May Destroy You, Fleabag, Disclaimer, The Agency, Industry, Slow Horses, Ted Lasso, The Capture und Gangs of London. London steht als Spielort für Serien auf Platz drei hinter L. A. und New York City. In dieser Folge ist Flo der Frage nachgegangen, warum sich London in der Serienproduktion so hervorgetan hat, zumal der Brexit England doch wirtschaftlich zurückgeworfen hat. Doch England war in der Filmindustrie schon immer präsenter als seine europäischen Nachbarländer. Allein durch die Sprache können sich englische Produktionen größere Märkte erschließen, wohingegen deutsche und französische Produktionen auf Sprachbarrieren im internationalen Raum stoßen. Auch die großen Streamingdienste haben sich in den letzten Jahren in Londoner Studios eingemietet. Serien wie „Game of Thrones” und die „Harry Potter”-Filme trugen maßgeblich dazu bei, dass sich in den ersten Dekaden der 2000er eine starke Infrastruktur in der Filmindustrie in London ausbauen konnte. Gerade im Bereich der visuellen Effekte (VFX) sind viele kleine Studios entstanden, die auf dem Weltmarkt eine führende Position eingenommen haben. Dies erklärt zum Teil, warum so viele Serien in London spielen. Ein weiterer Grund ist, dass viel Geld aus dubiosen Quellen nach London geflossen ist, welches neben der Finanzierung von Großbauprojekten wie The Shard oder One Hyde Park auch viele Schattenproduktionen in der Filmbranche finanziert hat. London ist als Geldwäscheanlage bekannt. In dieser Episode tauschen wir uns über solche Geschichten und Gerüchte aus und können viele eigene London-Erlebnisse einbringen. Flo ist fasziniert davon, wie sich die Skyline von London in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Micz kann von seiner Zeit in den 90ern berichten, als er in London lebte und die Gentrifizierung des Stadtteils Shoreditch miterlebte. London ist vielseitig und unberechenbar, wie sich die Stadt auch in den Serien spiegelt. Hinter der glatten Fassade lauern Abgründe, aber auch Chancen...
Shownotes
- Links zur Laufstrecke
- EGL083 | Wanderung | Komoot
- Squadrats
- Links zur Episode
- James Bond – Wikipedia
-
Friends – Wikipedia
- Chernobyl (Fernsehserie) – Wikipedia
- Shining (1980) – Wikipedia
-
Emily in Paris – Wikipedia
-
City of London - Wikipedia – Wikipedia
- Sex and the City – Wikipedia
-
London - Wikipedia – Wikipedia
- Black Doves - Wikipedia – Wikipedia
- MobLand - Wikipedia – Wikipedia
- Guy Ritchie - Wikipedia – Wikipedia
- Tom Hardy - Wikipedia – Wikipedia
- Pierce Brosnan - Wikipedia – Wikipedia
- Paramount+ - Wikipedia – Wikipedia
- Shaun the Sheep - Wikipedia – Wikipedia
- Game of Thrones - Wikipedia – Wikipedia
- Peaky Blinders (TV series) - Wikipedia – Wikipedia
- Harry Potter (film series) - Wikipedia – Wikipedia
- Dogs of Berlin – Wikipedia
- Kleo – Wikipedia
- Im Angesicht des Verbrechens – Wikipedia
- Achtsam Morden – Wikipedia
- Shoreditch – Wikipedia
- Tate Gallery of Modern Art – Wikipedia
- Clive Barker’s Book of Blood – Wikipedia
- Thatcherismus – Wikipedia
- Canary Wharf - Wikipedia – Wikipedia
- Big Bang (financial markets) - Wikipedia – Wikipedia
-
Kowloon Walled City - Wikipedia – Wikipedia
- List of tallest buildings and structures in London - Wikipedia – Wikipedia
- The Shard - Wikipedia – Wikipedia
- William the Conqueror - Wikipedia – Wikipedia
- Battle of Hastings - Wikipedia – Wikipedia
- The Gherkin - Wikipedia – Wikipedia
- Umgestaltung von Paris während des Zweiten Kaiserreichs – Wikipedia
- Centre Georges-Pompidou – Wikipedia
- Provisional Irish Republican Army - Wikipedia – Wikipedia
- Baltic Exchange bombing - Wikipedia – Wikipedia
- 1993 Bishopsgate bombing - Wikipedia – Wikipedia
- 1996 Manchester bombing - Wikipedia – Wikipedia
- Terraced house - Wikipedia – Wikipedia
- The Blitz - Wikipedia – Wikipedia
- Thomas Pynchon - Wikipedia – Wikipedia
- Barbican Centre - Wikipedia – Wikipedia
- Brutalismus – Wikipedia
-
Le Corbusier – Wikipedia
- The Agency (2024 TV series) - Wikipedia – Wikipedia
-
Michael Fassbender - Wikipedia – Wikipedia
- Attack the Block - Wikipedia – Wikipedia
- Hebbel am Ufer – Wikipedia
- Tino Sehgal – Wikipedia
- Industry (TV series) - Wikipedia – Wikipedia
- Terroranschläge am 7. Juli 2005 in London – Wikipedia
- Closed-circuit television - Wikipedia – Wikipedia
- Traffic and Environmental Zone - Wikipedia – Wikipedia
- Brand im Bahnhof King’s Cross St. Pancras – Wikipedia
-
The Capture (TV series) - Wikipedia – Wikipedia
- Adolescence (TV series) - Wikipedia – Wikipedia
- My Beautiful Laundrette - Wikipedia – Wikipedia
- Slow Horses - Wikipedia – Wikipedia
-
Apple TV+ - Wikipedia – Wikipedia
- Gary Oldman - Wikipedia – Wikipedia
- Willem Dafoe - Wikipedia – Wikipedia
- Ted Lasso - Wikipedia – Wikipedia
- I May Destroy You - Wikipedia – Wikipedia
-
Michaela Coel – Wikipedia
- Fleabag - Wikipedia – Wikipedia
- Phoebe Waller-Bridge – Wikipedia
- Peep Show (British TV series) - Wikipedia – Wikipedia
- Vierte Wand – Wikipedia
- Disclaimer (TV series) - Wikipedia – Wikipedia
- Severance (TV series) - Wikipedia – Wikipedia
- Alfonso Cuarón - Wikipedia – Wikipedia
- Harry Potter und der Gefangene von Askaban (Film) – Wikipedia
- Children of Men - Wikipedia – Wikipedia
- Gravity (2013 film) - Wikipedia – Wikipedia
- Cate Blanchett - Wikipedia – Wikipedia
- Gangs of London (TV series) - Wikipedia – Wikipedia
-
Sherlock (TV series) - Wikipedia – Wikipedia
- The Crown (TV series) - Wikipedia – Wikipedia
- Homepage | Film London
- https://film-london.files.svdcdn.com/production/Film-London-Code-of-Practice_2025-updated-July.pdf
Transcript
London, dieses geschichtsträchtige Kapital des Vereinigten Königreichs, hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Produktionsstandorte für internationale Serienproduktionen entwickelt. Die Stadt fungiert dabei nicht nur als pittoreske Kulisse, sondern wird zum narrativen Protagonisten, der die Geschichten formt und durchdringt. Was sich auf den Bildschirmen abspielt, ist jedoch mehr als bloße Unterhaltung – es ist eine vielschichtige Diagnose urbaner Pathologien, die gleichzeitig Symptom und Spiegel jener Strukturen ist, die sie zu kritisieren vorgibt.
Die Transformation Londons zum globalen Produktionszentrum lässt sich nicht ohne die wegweisende Rolle der Harry-Potter-Filmreihe verstehen. Zwischen 1997 und 2011 schuf diese Mega-Produktion nicht nur die infrastrukturellen Voraussetzungen mit dem Ausbau der Leavesden Studios, sondern etablierte auch eine kontinuierliche Beschäftigungsstruktur für tausende Crew-Mitglieder. Eine ganze Generation von VFX-Künstlern, Set-Designern und Kostümbildnern wurde hier ausgebildet, während die Produktionsausgaben von über einer Milliarde Pfund Hollywood demonstrierten, dass sich Investitionen in Großbritannien lohnen. Diese Entwicklung mündete 2007 in verbesserten Steueranreizen, die den Standort zusätzlich attraktiv machten.
Den entscheidenden Wendepunkt für die Serienproduktion markierte jedoch Game of Thrones. Die zwischen 2011 und 2019 produzierte Fantasy-Saga bewies, dass Premium-Fernsehen Kinoqualität erreichen kann, und etablierte London als Post-Production-Zentrum und VFX-Hub von Weltrang. Die britischen Crews demonstrierten Hollywood-Standards und setzten neue technologische Maßstäbe mit virtuellen Sets und Crowd-Simulationen. Diese Entwicklung ebnete den Weg für die Streaming-Revolution, die London endgültig als internationalen Produktionsstandort zementierte.
Das zeitgenössische Serienportrait der britischen Hauptstadt offenbart eine Stadt der Widersprüche. In kaum einer Produktion wird dies so brutal und ungeschönt dargestellt wie in „Gangs of London“ (2020-), der aufwendigsten britischen Crime-Serie überhaupt. Unter der Regie von Gareth Evans, bekannt für „The Raid“, entfaltet sich ein multi-ethnisches Crime-Babylon, in dem internationale Verbrecherfamilien – Iren, Albaner, Pakistaner, Kurden und Nigerianer – um die Kontrolle der Londoner Unterwelt kämpfen. Der Mord an Finn Wallace, dem mächtigsten Gangster der Stadt, löst einen Machtkampf aus, bei dem sein Sohn Sean (Joe Cole) auf Rache sinnt, während der Undercover-Cop Elliot Finch (Ṣọpẹ́ Dìrísù) die Organisation infiltriert. Die Serie wurde als „The Wire meets John Wick“ gefeiert – ein Gewaltexzess mit Stil, der revolutionäre Action-Sequenzen mit komplexen Machtstrukturen verbindet.
Diese rohe Darstellung urbaner Gewalt steht in starkem Kontrast zu Serien wie „Industry“, die das toxische Milieu der Londoner Finanzwelt seziert, oder „The Crown“, die die Verstrickungen zwischen Establishment und zweifelhaften Geschäftspartnern wie der Al-Fayed-Familie beleuchtet. Während „Sherlock“ die viktorianische Detektivtradition in die Gegenwart überführt und dabei die Stadt als labyrinthischen Tatort inszeniert, nutzt „Killing Eve“ London als Spielfeld für ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die mysteriöse Organisation „The Twelve“ ihre Operationen durch die undurchsichtigen Finanzstrukturen der City finanziert.
Besonders aufschlussreich sind jene Produktionen, die sich explizit mit Londons Rolle als globale Drehscheibe für Geldwäsche auseinandersetzen. „McMafia“ (2018) thematisiert direkt die Mechanismen, durch die schmutziges Geld in der Londoner City gewaschen wird, während „The Night Manager“ den Waffenhandel über die britische Hauptstadt abwickelt. „Devils“ (2020-2022) porträtiert die City of London als moralfreie Zone, in der alles käuflich ist. Guy Ritchies „The Gentlemen“ treibt diese Thematik auf die Spitze, indem Cannabis-Gewinne durch eine Filmproduktionsfirma gewaschen werden – eine beißende Satire auf die Verschränkung von Unterhaltungsindustrie und organisiertem Verbrechen.
Die jüngere Serienlandschaft zeigt dabei eine bemerkenswerte Vielfalt in der Auseinandersetzung mit urbanen Traumata. „I May Destroy You“ von Michaela Coel durchbricht Tabus in der Darstellung sexueller Gewalt und ihrer Aufarbeitung, während „Fleabag“ die emotionale Verlorenheit einer Generation zwischen ironischer Distanz und verzweifelter Sehnsucht nach Authentizität einfängt. „Disclaimer“ von Alfonso Cuarón dekonstruiert die Mechanismen medialer Skandalisierung, und „The Capture“ führt vor, wie allgegenwärtige Überwachungstechnologie zur Manipulation von Wahrheit eingesetzt werden kann.
Die Architektur der Stadt selbst wird dabei zum stummen Zeugen dieser Narrative. The Shard, mit seinen 310 Metern das höchste Bauwerk Großbritanniens, hat zur Prägung des Begriffs „Oligarchitektur“ beigetragen – eine Architektur, die Macht und Reichtum manifestiert, während sie gleichzeitig soziale Ungleichheit zementiert. Norman Fosters Gherkin und der Tower 42, zwischen 1971 und 1979 nach Plänen des aus der Schweiz stammenden britischen Architekten Richard Seifert erbaut, ragen als Symbole der Finanzmetropole in den Himmel. Diese Wolkenkratzer bilden die vertikale Kulisse für Serien wie „Succession“, in der die Waystar Royco-Dynastie ihre Londoner Operationen von gläsernen Türmen aus orchestriert.
Selbst vermeintlich leichtere Produktionen wie „Ted Lasso“ können sich der Gravitation Londons nicht entziehen. Die Serie mag vordergründig vom amerikanischen Optimismus handeln, der auf britischen Zynismus trifft, doch unter der Oberfläche verhandelt sie Fragen von Zugehörigkeit und Identität in einer globalisierten Metropole. „Slow Horses“, basierend auf Mick Herrons Romanen, zeigt die Kehrseite des Geheimdienstapparats – gescheiterte Spione, die in einem heruntergekommenen Büro am Rande der Stadt ihr Dasein fristen, während die glänzende Fassade des MI5 die wahren Machenschaften verbirgt.
Diese Vielfalt der Perspektiven offenbart London als narrative Projektionsfläche par excellence. Die Stadt mit ihrer über zweitausendjährigen Geschichte – von der römischen Gründung Londiniums im Jahr 43 n. Chr. über die strategische Bedeutung als Handelshafen bis zur modernen Finanzmetropole – verleiht den Geschichten eine Tiefe, die über das rein Visuelle hinausgeht. Die noch heute sichtbaren Fragmente der römischen Stadtmauer oder die Erinnerung an Boudiccas Zerstörung der Stadt im Jahr 60 n. Chr. schaffen ein historisches Palimpsest, auf dem sich zeitgenössische Narrative entfalten.
Was sich in dieser Serienlandschaft manifestiert, ist ein komplexes Geflecht aus künstlerischer Ambition, ökonomischen Zwängen und narrativer Selbstreflexion. Die paradoxe Situation wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass viele dieser kritischen Produktionen durch genau jene Strukturen finanziert werden, die sie anprangern. Die großzügige Filmförderung, die laxe Registrierung von Produktionsfirmen und die als „kreative Buchhaltung“ euphemisierte Steuervermeidung schaffen ein Umfeld, in dem Kunst zur perfekten Cover-Story wird – schließlich ist sie „subjektiv“.
Die besten Serien über London sind jene, die die Stadt nicht romantisieren, sondern ihre Abgründe ausleuchten. Von der brutalen Gangster-Oper „Gangs of London“ über die Finanzwelt-Satire „Industry“ bis zur Geheimdienstkritik in „Slow Horses“ – sie alle zeichnen das Bild einer Stadt, die ihre Seele verkauft hat, aber großartige Geschichten darüber zu erzählen weiß. Doch gerade diese kritische Perspektive wird durch die Strukturen ermöglicht, die sie hinterfragt. So entsteht ein faszinierendes Spannungsfeld zwischen künstlerischer Integrität und ökonomischer Abhängigkeit, das die Serienproduktion in London zu einem Seismographen zeitgenössischer urbaner Realitäten macht. Die Stadt erzählt ihre Geschichte durch die Serien, die in ihr produziert werden – und diese Geschichten erzählen mehr über London, als es auf den ersten Blick scheinen mag.









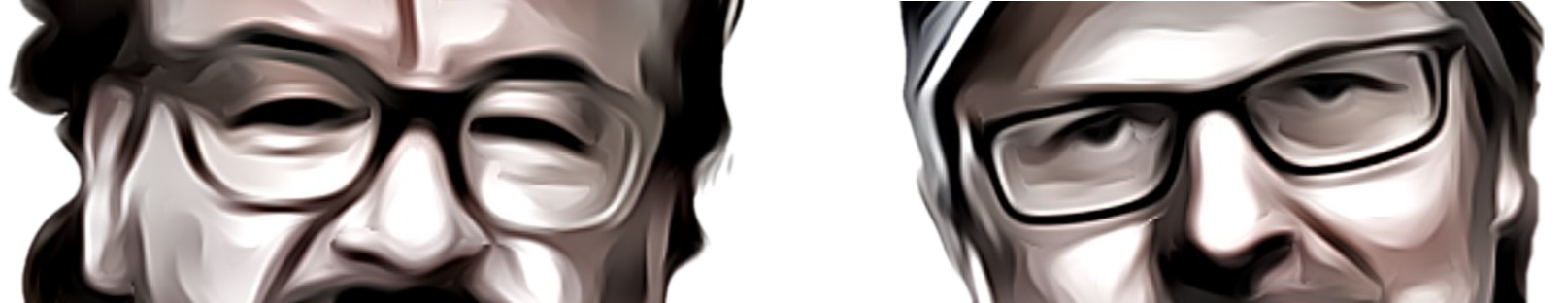


Schreibe einen Kommentar