EGL082 Zombies in Psychoanalyse: Jenseits des Lustprinzips
In dieser Episode untersuchen wir die Figur des Zombies aus psychoanalytischer Perspektive. Beginnend mit Sigmund Freuds hangeln wir uns in der Reihenfolge der Geburtsjahre durch die jeweiligen Theorien. Die Bedrohung und der Horror der Zombies ist dabei mit der Psyche der Beobachter:innen verschlungen, ihr liegt immer wieder ein "Plot-Twist" zugrunde, der da heißt: was löst die Inszenierung des Zombies in uns aus, weswegen wir uns fürchten und unwohl fühlen? Der Horror ist nicht der Zombie, sondern die Psychodynamik in uns. Vor dem Hintergrund von Freuds Konzepten des Unheimlichen und des Todestriebs erscheint uns der Zombie als Rückkehr des Verdrängten mit destruktiven inneren Tendenzen (Todestrieb) gedeutet. Bei Carl Gustav Jung konfrontiert uns die untote Figur mit unserem Schattenaspekt der Psyche, ohne Hoffnung auf Individuation. Melanie Klein lässt uns im Zombie mit dessen Fixierung auf der paranoid-schizoiden Position in unsere eigene kindliche Seele blicken. Diese Gewaltstrukturen alignen wir mit dem in Klaus Theweleits *Männerphantasien* dargestelten Grauen. In der lakanschen Theorie dringt mit dem Zombie ein Subjekt außerhalb der symbolischen Ordnung in unsere geordnete Welt ein – ein Begehren ohne Sprache, das jeder kulturellen Vermittlung entzogen ist. Wir kamen im Podcast nicht mehr dazu die Theorie des Abjekten von Julia Kristeva vorzuführen, wonach der Zombie als abjekter Körper die Grenzen von Subjektivität, Sprache und symbolischer Ordnung infrage stellt. Das holen wir im Text zur Episode nach, in dem wir Kristevas Verständnis des Ekels, das Unintegrierbare und das körperlich Verstörende als Herausforderung für ein stabiles Ich beschreiben. Warum das alles? Weil die vorangegangene Episode 81 den Schinken "28 Years Later" durch die Straße zieht.
Shownotes
- Der Kulturtheoretiker Klaus Theweleit – Warum Männer hassen | SWR2 Wissen
- Klaus Theweleit über „Männerphantasien“ Die Angst vor der Körperauflösung | DLF Kultur
- Powers of Horror: An Essay on Abjection, Julia Kristeva, 1980
- Welcome to the Desert of the Real auf Archive.org
- Welcome to the Desert of the Real, Verso Books, 2002
- Žižek and Media Studies: A Reader, edited by Matthew Flisfeder and Louis-Paul Willis, 2014
- "The pervert's guide to cinema" w/ Slavoj Zizek (Dir:Sophie Fiennes, 2006)
- Freud: Der Zombie als Rückkehr des Verdrängten
- Jung: Der Zombie als Schatten
- Melanie Klein: Die Gewalt des paranoid-schizoiden Zombies
- Jacques Lacan: Der Zombie als Subjekt jenseits der Ordnung
- Julia Kristeva und das Abjekt: Zombies als Grenze des Ich
Transcript
Verwandte Episoden
Anmerkung der Red.: die Hintergrundgeräusche dieser Episode passen oft gut zum Vordergrund. Besonders auffällig der Moment (den Flo einen „Eigentlich-Moment“ nennt) in Minute 31:20.
Nachdem Flo vor 14 Tagen den „Zombie“-Film 28 Years Later filetiert und goutiert hat, schiebt Micz in dieser Episode den Servierwagen mit den Desserts in eure Ohren. Im Angebot heute eine Figur, die gleichermaßen kultureller Pop-Mythos wie tiefenpsychologisches Symptom ist: der/die/das Zombie. Was sagt uns diese schleppende, lebendig tote Gestalt über das Unbewusste, über Angst, Trieb und Ich-Struktur? Was löst diese namenlose Angst (Bion) in uns aus, wenn Zombies sich vor die Kamera schleppen oder – wie bei 28 Days Later – sich mit maximaler Geschwindigkeit auf die Protagonist:innen zustürzen?
Wir blicken dabei in der Episode auf Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Melanie Klein und Jacques Lacan, deren Konzepte wir mit der Figur des Zombies in Verbindung setzen. Auch bekommt Klaus Theweleits Buch Männerphantasien einen Platz im Rampenlicht. Hier analysiert Klaus Theweleit anhand der Tagebücher und Schriften von Freikorpssoldaten die psychosexuelle Struktur faschistischer Männlichkeit, die sich durch Angst vor weiblicher Körperlichkeit, Abwehr von Auflösung und ein gewaltförmiges Bedürfnis nach Ich-Grenzstabilisierung auszeichnet. Das ist bei Melanie Klein mit verortet.
Freud: Zombies als Rückkehr des Verdrängten
Für Sigmund Freud ist das Unheimliche nicht das völlig Fremde, sondern das einst Vertraute, das verdrängt wurde und nun entstellt zurückkehrt. Der/die/das Zombie ist genau das: Es ist nicht das gänzlich Andere, sondern das, was wir kennen – nur in einer unhaltbaren Form. Eine verweigerte Leiche, ein Verstoß gegen die Ordnung des Todes. Der Zombie lässt sich zugleich als Symbol für den Todestrieb lesen – jenes triebhafte Streben nach Auflösung, Stillstand und Rückkehr in den anorganischen Zustand, das Freud in Jenseits des Lustprinzips (1920) formulierte. Der lebende Tote wird so zum Ausdruck eines psychischen Impulses, der jenseits von Lust und Unlust operiert.
Jung: Zombies als Schatten
Mit Carl Gustav Jung können wir Zombies als Schattenfiguren beschreiben — verdrängte, unbewusste Anteile des Selbst, die nicht ins bewusste Ich integriert wurden. Der Zombie verkörpert den abgespaltenen Teil der Psyche, das Unbewältigte, das sich verselbstständigt. Er ist zugleich Ausdruck einer gescheiterten Individuation, jener Prozess, in dem sich das Selbst im Lauf des Lebens entfalten soll. Der Zombie hat keine Entwicklung mehr vor sich. Er ist regressiv, mechanisch, nicht mehr beziehungsfähig. Er ist psychisch eingefroren. Der Horror in uns ist der Blick nach innen, den der Zombie auslöst, auf alles, was wir noch (?) im Schatten liegen haben.
Melanie Klein: Die Gewalt des paranoid-schizoiden Zombies
Melanie Klein deutete frühe Ich-Zustände als dominiert von der Angst vor dem Bösen, was sie die paranoid-schizoide Position nannte. Der Zombie erscheint hier als Fixierung auf eben dieser Phase: eine psychische Struktur, die zwischen idealisierten und zerstörerischen Objekten hin- und herpendelt. Diese Phase der Teilobjekte, in der die Welt keinen Zusammenhalt, keine Ordnung und kein Körperbild besitzt, überwindet der/die/das Zombie nie.
In Parallele dazu lässt sich die Zombiegewalt mit der Psychodynamik vergleichen, die Klaus Theweleit in Männerphantasien beschrieb: Die rigide Männlichkeit der Freikorps-Soldaten basiert auf Spaltung, Projektion und einer tiefen Angst vor psychischer Auflösung. Die eigene Gewalt und Bosheit werden abgewehrt und auf die ankommende Flut von Körpern projiziert. In Theweleits Schriften die Arbeiter:innen, in unserem Verständnis die Zombies, bei Melanie Klein die Mutter.
Jacques Lacan: Zombies als Subjekte jenseits der Ordnung
Jacques Lacan hätte den Zombie wohl als Subjekt außerhalb der symbolischen Ordnung bezeichnet. Er hat keinen Zugang mehr zu Sprache, Begehren oder kultureller Vermittlung. Er/sie/es ist ein Realitätsrest, eine Figur, die nicht mehr durch das Symbolische gebunden ist. Das Begehren ist nicht artikuliert, sondern unstillbar. Zombies jagen nach Fleisch oder Hirn, ein Begehren ohne Objekt, eine Bewegung ohne Richtung.
Was wir noch auf dem Zettel hatten, aber aufgrund der späten Aufnahme nach Mitternacht (Geisterstunde) waren Donald W. Winnicott (Zombies als Wesen ohne Übergangsraum), Michael Balint (Der Zombie als Ausdruck einer Grundstörung), Heinz Kohut (Zombies als fragmentiertes Selbst, Kollaps narzisstischer Struktur), Günter Ammon (Zombies als Ausdruck des „Lochs im Ich“, dramatische ich-struktureller Defizite) und Slavoj Žižek (Das postmoderne Subjekt: leer, fragmentiert, entkoppelt, Die Simulation der Realität, Das Reale bricht durch – der Zombie als Traumafigur, Politische Passivität – Untote Gesellschaft).
Julia Kristeva und das Abjekt: Zombies als Grenze des Ich
In der Episode blieb leider auch keine Zeit, die Psychoanalytikerin Julia Kristeva zu besprechen. Das holen wir hier nach:
Julia Kristeva, 1941 in Bulgarien geboren und seit 1966 in Frankreich lebend, ist eine Stimme im französischen Poststrukturalismus, der feministischen Theorie und der Kulturkritik. Als Linguistin, Psychoanalytikerin und Literaturtheoretikerin hat sie ein breites theoretisches Werk geschaffen. Besonders einflussreich ist ihr Konzept der Abjektion – jenes psychische und kulturelle Verfahren, durch das wir all das ausschließen müssen, was unsere Identität, unsere Subjektwerdung bedroht: etwa Körperflüssigkeiten, Leichen, Ausscheidungen.
Das Abjekte ist das, was „nicht ganz Objekt und nicht ganz Subjekt“ ist, etwas, das uns einst zugehörte, nun aber abgestoßen werden muss, um die Grenzen des Ich zu stabilisieren. Zombies verkörpern in Kristevas Sinn eine Grenzfigur des Abjekten: Er ist weder richtig tot noch lebendig, verweilt im Zwischenzustand, bricht mit symbolischen Ordnungen von Leben und Tod, von Subjekt und Objekt, von Ich und Nicht-Ich.
Indem Zombies diese Ordnung stören, werden sie zu radikal abjekten Figuren. Körperlichkeit – verwesend, durchlässig, undifferenziert – ruft Ekel hervor, weil er das Subjekt mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. In diesem Sinne sind Zombies nicht nur Monster, sondern auch Spiegel: sie zeigen das Ich in Auflösung, den Preis der Subjektwerdung und die Angst vor dem Verlust der symbolischen Ordnung.
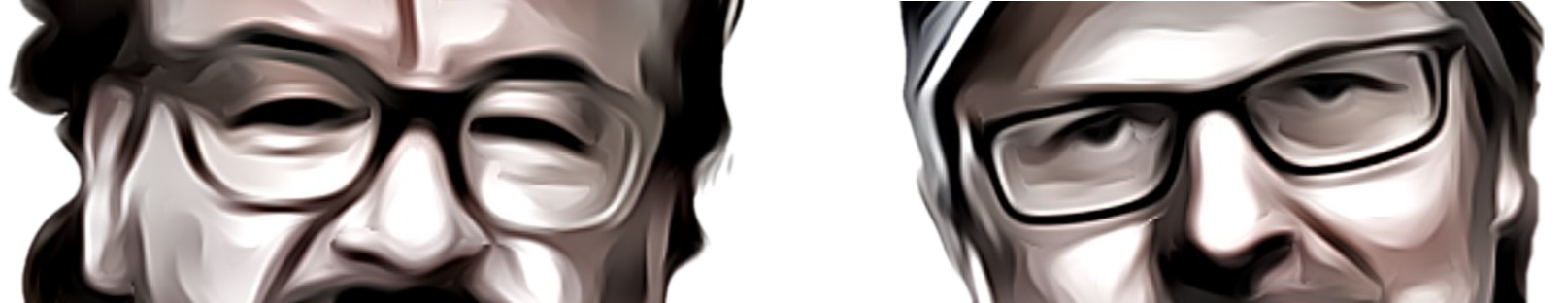


Schreibe einen Kommentar